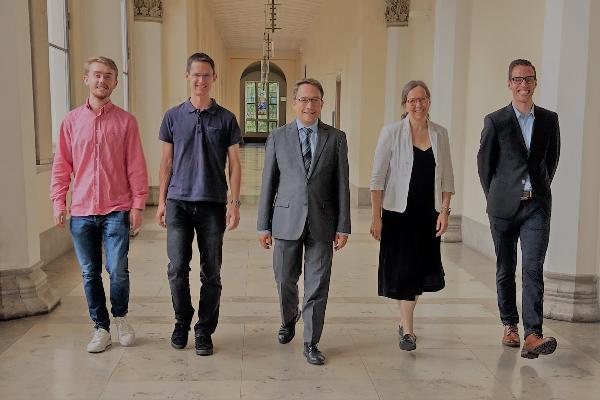Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. theol. habil. Dr. iur. Burkhard Berkmann
Lehrstuhlinhaber
Sekretariat
Ludwig-Maximilians-Universität
Katholisch-Theologische Fakultät
Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für Theologische Grundlegung des Kirchenrechts, Allgemeine Normen und Verfassungsrecht sowie für Orientalisches Kirchenrecht
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Raum C 311
+49 89 2180-2483
sekretariat.berkmann@kaththeol.lmu.de
Öffnungszeiten: Das Sekretariat ist montags bis freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr für Sie geöffnet.
Mitarbeitende
| Name | Telefon | Raum | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Andrassy, Antje | sekretariat.berkmann@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-2483 | C 311 | Sekretärin |
| Brechtel, Lukas | lukas.brechtel@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-2484 | C 311 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Lopez Jansa, Diego | lopez@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-2484 | C 311 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Emeriti
Übersicht
Weitere Informationen zum Profil des Lehrstuhls und den verschiedensten Aktivitäten finden Sie auf unseren jeweiligen Unterseiten: