Lehrstuhlinhaberin

Lehrstuhlinhaberin
ERASMUS-Beauftragte der Katholisch-Theologischen Fakultät, Frauenbeauftragte der Katholisch-Theologischen Fakultät
Sekretariat
Ludwig-Maximilians-Universität
Katholisch-Theologische Fakultät
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Raum C 201
Dr. Sascha Ruppert-Karakas
+49 89 2180-3247
religionspaedagogik@kaththeol.lmu.de
Öffnungszeiten:
Dienstag: 10 bis 12 Uhr
Mittwoch: 10 bis 12 Uhr
Donnerstag: 10 bis 12 Uhr
Tagung "Den Religionsunterricht in Bayern konfessionell-kooperativ weiterentwickeln" 02/2024
17.04.2024
Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht startet in Bayern
LMU bietet deutschlandweit einzigarten Standortvorteil für die Qualifizierung von Theologiestudierenden für das neue Unterrichtsmodell
Zum kommenden Schuljahr 2024/25 wird in den ersten beiden Jahrgangsstufen der Grundschule der konfessionelle Religionsunterricht in Kooperation (koRUk) flächendeckend ermöglicht. Das teilte das Bayerische Kultusministerium am 08.04.2024 in einem Schreiben an alle bayerischen Grundschulen mit. Damit können evangelische und katholische Schülerinnen und Schüler gemeinsam von einer Lehrkraft unterrichtet werden, die entweder katholisch oder evangelisch sein kann – eine Option, die in Bayern bislang nur im Rahmen von Projektversuchen möglich war.
Standortvorteil der LMU München durch drei starke Theologien
Die LMU München bietet für die notwendige konfessionssensible und ökumenisch orientierte Qualifizierung von Theologiestudierenden einen einzigartigen Standortvorteil. Nur in München finden drei Theologien, bestehend aus einer starken Katholisch-Theologischen als auch Evangelisch-Theologischen Fakultät und zudem einem Institut für Orthodoxe Theologie. Durch die Kooperation der unterschiedlichen Konfessionen in den Lehrveranstaltungen lernen Studentinnen und Studenten schon in ihrem Studium, was es bedeutet, vom gemeinsamen Christlichen her die Besonderheit der Konfessionen kennen- und schätzen zu lernen.
Damit können Münchner Studierende während des Studiums wichtige Qualifikationen erwerben, die später in der Praxis des Religionsunterrichts gefragt sind: Kundig in der Vielfalt der Konfessionen, didaktisch qualifiziert, konfessionssensibel und ökumenisch orientiert zu unterrichten, geschult, das gemeinsame Christliche multiperspektivisch ausgefaltet in den Konfessionen zu erkennen. Die Theologien an der LMU haben sich dieses Anliegen zu eigen gemacht und werden zukünftig ihr Lehrangebot noch deutlicher auf diese Bedarfe ausrichten.
Vorteile des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts
In anderen Bundesländern wie Niedersachsen oder Baden-Württemberg wird konfessionell-kooperativer Religionsunterricht bereits seit vielen Jahren erfolgreich an verschiedenen Schularten angeboten. Dass Bayern nun nachzieht, hat sowohl inhaltliche als auch pragmatische Gründe. Denn von dem neuen Modell können sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Schulen selbst profitieren. "V. a. in der Grundschule ist es auch aus pädagogischen Gründen wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht gemeinsam lernen können und nicht getrennt werden", unterstreicht Ulrike Witten, Inhaberin des Lehrstuhls für evangelische Religionspädagogik. Der „koRUk bietet eine wichtige Weiterentwicklung bisheriger Organisationsmodelle des Religionsunterrichts in Bayern und wird gerade aufgrund seines verbindenden Charakters in den Grundschulen viel Zuspruch erfahren", so Mirjam Schambeck sf, Inhaberin des Lehrstuhls für katholische Religionspädagogik.
In Zeiten einer vielfältiger werdenden Gesellschaft wird es auch in der Schule immer wichtiger, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit Pluralität und Heterogenität auch in Bezug auf Religion umzugehen. Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht kommt diesen Aufgaben besonders nach. Dies ist nicht nur für den Religionsunterricht ein wichtiger Gewinn. Wer multiperspektivisch denken kann und weiß, dass Uniformität nicht die Lösung, sondern das Problem ist, wird auch in demokratischen Prozessen der Differenziertheit mehr zutrauen als populistisch verkürzenden Reden.
Die Einführung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Bayern ist von daher ein wichtiger Meilenstein: für die Zukunftsfähigkeit des Religionsunterrichts, für die Demokratiebildung in der Schule, zuvorderst und zuerst aber für die Schülerinnen und Schüler und was sie an großen Fragen umtreibt.
Weitere Informationen zum Studienangebot der Theologien an der LMU München: https://www.kaththeol.lmu.de/de/studium/index.html und https://www.evtheol.lmu.de/de/index.html sowie https://www.orththeol.uni-muenchen.de/stud_lehre/index.html
Erst im Februar 2024 veranstalteten die beiden evangelisch- und katholisch-theologischen Lehrstuhlinhaberinnen für Religionspädagogik an der LMU München, Prof. Dr. Ulrike Witten und Prof. Mirjam Schambeck sf, mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Bamberg, Prof. Dr. Konstantin Lindner und Prof. Dr. Stefanie Lorenzen eine Fachtagung zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Bayern. Hier nahmen über 100 Akteurinnen und Akteure aus Schule, Wissenschaft, der staatlichen und kirchlichen Verwaltungs- und Bildungsarbeit teil.
Der Tagungsbericht zum "Miteinander für einen qualitätsvollen Religionsunterricht in Bayern“ samt Tagungsvideo ist unter https://www.evtheol.lmu.de/de/aktuelles/newsuebersicht/news/tagungsbericht-den-religionsunterricht-in-bayern-konfessionell-kooperativ-weiterentwickeln.html einzusehen.
Weiterführende Informationen für Medienvertreterinnen und -vertreter:
Kontakt für inhaltliche Rückfragen:
Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Katholisch-Theologischen Fakultät der LMU München
mirjam.schambeck@lmu.de
Prof. Dr. Ulrike Witten
Lehrstuhl für Evangelische Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU München
ulrike.witten@lmu.de
Instagram: @ev.relpaed.lmu
Den Religionsunterricht in Bayern konfessionell-kooperativ weiterentwickeln
Fachtagung am 01./02. Februar 2024 in Augsburg-Leitershofen
Miteinander für einen qualitätsvollen Religionsunterricht in Bayern - TagungsberichtReligionslehrer:innen, Lehramtsstudierende, Seminarlehrkräfte, Fortbildungsverantwortliche, Verantwortungsträger:innen aus Kirchen und Staat sowie Uni-Dozierende haben am 01./02. Februar 2024 in Augsburg-Leitershofen zur Weiterentwicklung des konfessionellen Religionsunterrichts in Bayern getagt.
Die von den evangelischen und katholischen Religionspädagogik-Lehrstühlen der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Ludwig-Maximilians-Universität München ausgerichtete Veranstaltung fokussierte Potenziale und beachtenswerte Perspektiven konfessionell-kooperativer Settings von Religionsunterricht.
In ihren Darlegungen boten Prof. Dr. Konstantin Lindner und Prof. Dr. Stefanie Lorenzen (Universität Bamberg) Einblicke in religionsdemografische Entwicklungen bei den Schüler:innen an bayerischen Schulen und zeigten bereits bestehende Möglichkeiten auf, konfessionell-kooperativen Religionsunterricht zu organisieren. Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf und Prof. Dr. Ulrike Witten (LMU München) wiederum stellten religionsdidaktische Perspektiven zur Diskussion, wie der Religionsunterricht in Bayern weiterentwickelt werden kann – und zwar so, dass konfessionell-kooperative Settings vom Reichtum des gemeinsam Christlichen her gestaltet werden. Dr. Yauheniya Danilovich (Universität Münster) ergänzte orthodoxe Perspektiven auf den bayerischen Religionsunterricht. Die über 100 Teilnehmer:innen diskutierten die Vorträge sehr intensiv in Bezug auf Konsequenzen für ihren jeweiligen Berufskontext und waren damit bestens für den zweiten Tag der Tagung präpariert.
Diesen eröffneten die Leiterin der Konferenz der Schulreferenten der bayerischen (Erz-)Bistümer Ordinariatsrätin Dr. Sandra Krump und Oberkirchenrat Michael Blumtritt, Leiter der Abteilung Gesellschaftsbezogene Dienste im Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, mit ihrem dialogisch vorgetragenen Statement zu: „Wo stehen die Kirchen im Blick auf den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Bayern?“
In den anschließenden Workshops mit Expert:innen wurden schließlich Praxisoptionen konfessionell-kooperativer Settings vorgestellt und diskutiert: Innensichten der beiden in Bayern laufenden Schulprojekte RUmeK (Grund- und Mittelschulen) und StReBe (Berufsschulen), Ideen zur Gestaltung entsprechender Lernumgebungen an Gymnasien, Umsetzungsoptionen in der fachwissenschaftlich-theologischen Lehrkräftebildung an Universitäten, aber auch im Referendariat und in der Fortbildung von Religionslehrer:innen.
Die Workshop-Ergebnisse und die durchwegs positive Tagungsstimmung zeigten: Die Weiterentwicklung des evangelischen und des katholischen Religionsunterrichts in Bayern ist auf einem niveauvollen Weg – aus allen Akteursgruppen zeigte sich hohe Bereitschaft, diese Gestaltungsaufgabe anzugehen: Miteinander!
TagungsideeÖffentlich ist der Religionsunterricht immer stärker angefragt und steht vor der Herausforderung, seine Organisationsform wie auch seine Inhaltlichkeit angesichts veränderter religionsdemografischer, theologischer wie gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. In vielen Bundesländern haben sich bereits konfessionell-kooperative Modelle für den Religionsunterricht etabliert, die auch für Bayern inspirierend sind.
Die Fachtagung „Den Religionsunterricht in Bayern konfessionell-kooperativ weiterentwickeln“ richtet sich an Multiplikator:innen in Schule, Universität und auf staatlicher wie kirchlicher Entscheidungsebene. In unterschiedlichen Vorträgen, Diskussionsrunden und Austauschformaten werden die gegenwärtige Situation analysiert, anstehende Reformbedarfe identifiziert sowie mögliche Ausgestaltungen eines konfessionell-kooperativ ausgerichteten Religionsunterrichts entwickelt.
Veranstalter:innen
- Prof. Dr. Konstantin Lindner, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
- Prof. Dr. Stefanie Lorenzen, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
- Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf, Ludwig-Maximilians-Universität München
- Prof. Dr. Ulrike Witten, Ludwig-Maximilians-Universität München
- aeed - Bildung, Schule, Religionspädagogik. Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Erzieher in Deutschland
- dkv - Fachverband für religiöse Erziehung und Bildung
- Erzbistum Bamberg. Hauptabteilung Schule und Religionsunterricht
- Erzdiözese München-Freising. Ressort Bildung
- Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, Abtl. Gesellschaftsbezogene Dienste
Lieber Bildungspläne entrümpeln, als Fächer wie Religionsunterricht zusammenstreichen
Reaktion auf Vorschlag von Kultusministerin Anna Stolz, Religionsunterricht zu streichen, um Söder-Erlass umzusetzen
München, 29.01.2024
Eine weitere Stunde Deutsch und Mathe soll in der Grundschule her: mehr Sprachbefähigung, mehr Deutschlernen, mehr Rechenverständnis, überhaupt bessere Allgemeinbildung an bayerischen Grundschulen! So weit, so gut.
Dass dafür Fächer zusammengestrichen werden, anstatt Bildungspläne zu entrümpeln, mag verwundern. Nicht nur erfahrene Grundschullehrer:innen wissen um die Stofffülle und die immer weniger werdenden Wiederholungsphasen im Deutsch- und Matheunterricht. Weniger wäre auch in Deutschland mehr – das stellen die erneuten PISA-Testsieger in Irland, Estland oder Finnland klar vor Augen.
Noch mehr verwundert, dass ausgerechnet Religion als Beispiel für das Streichungsprogramm genannt wird. Ein Fach, in dem Schüler:innen lernen, auch über große Fragen differenziert zu reden und v. a. nachzudenken (!) und Textverständnis und Sprachfähigkeit von grundlegender Bedeutung sind – in dem also genau das thematisiert wird und Anwendung findet, was Allgemeinbildung anzielt –, soll von Kürzungen betroffen sein?
Dass Religionsunterricht von Schüler:innen geschätzt wird, zeigen empirische Untersuchungen je neu. Dass es genau in Krisenzeiten wie den unseren wichtig ist, Raum für das Unlösbare zu geben und mit Schüler:innen darüber zu sprechen, was Angst macht, aber auch Vertrauen und Hoffnung schenkt, auch. Dass wir gerade jetzt das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen stärken müssen, was Demokratie braucht und freies Menschsein fördert, ebenso. Im Religionsunterricht geht es nicht nur um irgendetwas, sondern um den Menschen selbst und wie wir gut zusammenleben können.
Insofern bleibt, die Verwunderung zu wiederholen und die Forderung zu unterstreichen: Lieber Bildungspläne entrümpeln als das Fach Religionsunterricht zusammenstreichen!
Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf, Lehrstuhlinhaberin für das Fach Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Katholisch-Theologischen Fakultät der LMU München
Forschungs- und Lehrprofil
Der Lehrstuhl für Religionspädagogik und -didaktik des Religionsunterrichts widmet sich der Reflexion, Analyse und Entwicklung von religiösen Lehr-Lern-Dynamiken. Hermeneutische und empirische Perspektiven prägen das ideologiekritische Forschen. Die Befähigung zur kritischen Wahrnehmung von Lerngeschehen wie auch zur Gestaltung reflektierter Bildungsprozesse ist das Ziel religionspädagogischer und -didaktischer Lehre.
Aktuell setzen wir folgende Schwerpunkte:
- Antisemitismuskritische Bildung
- Gott in der Postmoderne kommunizieren: Mystagogisches Lernen
- Religion und Bildung
- Zukunftsfragen des Religionsunterrichts
- Konfessionell-Kooperative Lehr-Lern-Formate
- Digitalität im Religionsunterricht
- Konfessionslosigkeit und Religionsunterricht
- Interreligiöse Kompetenzen
- Film und Religionsunterricht
Mitarbeitende
| Name | Telefon | Raum | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Ruppert-Karakas, Sascha | religionspaedagogik@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-3247 | C 201 | Sekretär |
| Eichhorn-Remmel, Friederike | friederike.eichhorn@lmu.de | +49 89 2180-6870 | C 206 | Akademische Rätin a. Z. |
| Fella, Daniela | D.Fella@lmu.de | +49 89 2180-6870 | C 206 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Fischer, Thomas D. | fischer.thomas@lmu.de | +49 89 2180-3585 | C 205 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Reiner, Martina | martina@reiner@lmu.de | +49 89 2180-3585 | C 205 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Aktuelles / Termine
-
 01 Feb—02 FebDen Religionsunterricht in Bayern konfessionell-kooperativ weiterentwickeln
01 Feb—02 FebDen Religionsunterricht in Bayern konfessionell-kooperativ weiterentwickelnFachtagung für Multiplikator:innen in Schule, Universität und auf Entscheidungsebene - Ein Tagungsbericht
-
Seminar "Mehr als Medienkritik. Digitale Medienkompetenz im Religionsunterricht"
Das Seminar findet im kommenden Sommersemester als Blockveranstaltung statt.
-
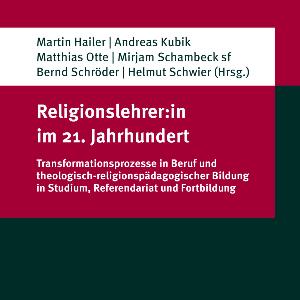 Neuerscheinung: "Religionslehrer:in im 21. Jahrhundert"
Neuerscheinung: "Religionslehrer:in im 21. Jahrhundert"Einblicke in eine anstehende Überprüfung und Neugestaltung theologisch-religionspädagogischer Bildung. Mit Beiträgen von Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf.
Abschlussarbeiten
Für Abschlussarbeiten in der Religionspädagogik schlägt der Lehrstuhl folgende Themenbereiche vor, mit denen Sie die zugeordneten Personen mit konkreten Ideen und Konzepten ansprechen können:
- Antisemitismuskritische Bildung (Prof.in Dr.in Schambeck sf)
- Religionsunterricht und Konfessionslosigkeit (Prof.in Dr.in Schambeck sf)
- Ökumenische Religionsdidaktik und Zukunftsfragen des Religionsunterricht (Prof.in Dr.in Schambeck sf)
- Film und Religionsunterricht (StD Fischer)
- Digitalität und Religionsunterricht (StD Fischer)
- Argumentieren im Religionsunterricht (AkadR Reiner)
- Empirische Unterrichtsforschung (AkadR Reiner)
Aktuell betreut Fr. Prof. Dr. Schambeck sf das Dissertationsprojekt von Fr. Elisabeth Fock zum Thema "Eine religionspädagogische verantwortete Rede von Körperlichkeit - Empirische und hermeneutische Erkundungen".


















